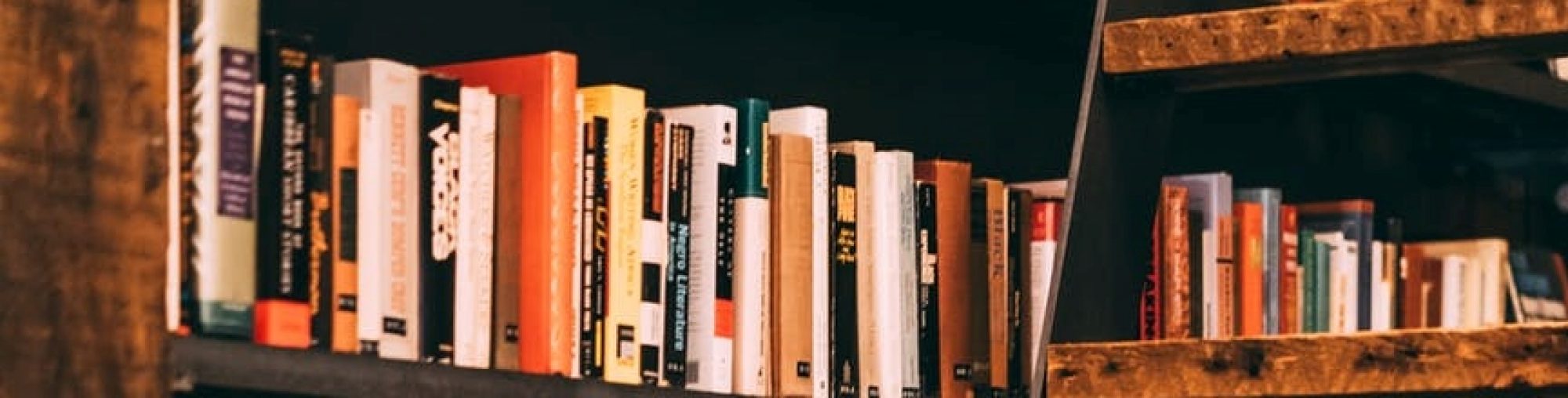Ich habe in Tübingen Philosophie im Hauptfach, Deutsche Literatur und Sozialwissenschaft in den Nebenfächern studiert. Die Schwerpunkte, die ich hier nach und nach gelegt habe, waren einmal historisch die Antike Philosophie, zuerst Platon, dann auch Aristoteles, zum anderen das 19. und 20. Jahrhundert.
Die Auseinandersetzung mit der Philosophiegeschichte hat für mich eine systematisch-methodische Perspektive: Phänomenologie, Hermeneutik und Dialektik, die für mich sehr stark von der Auseinandersetzung der Philosophie der Neuzeit mit der Tradition des Denkens geprägt worden sind. Ganz konkret: Wenn wir uns heute mit der Antiken Philosophie, ihren metaphysischen, ontologischen und existenziellen Fragen auseinandersetzen, dann immer vor dem Hintergrund der Epochenwandel, der ‚Einführung des Subjekts in die Philosophie‘, mit der die Frage nach dem Substanzdenken noch einmal neu aufgerollt wurde, der Transzendentalphilosophie, die ebenfalls für sich in Anspruch nahm, die ‚Erste Philosophie‘ von Antike und Neuzeit kritisch zu sichten, des Aufkommens des Positivismus, der Psychoanalyse und des Denkstil der Philosophischen Anthropologie – um nur einige zu nennen.
Sich hier aus der gegenwärtigen Situation in der Geistesgeschichte zu verorten, bedeutet für mich, die Bewegung der Phänomenologie, wie sie sich seit Husserl entwickelt hat, als Haltung im Umgang mit philosophischen Fragen weiterzutreiben: Was macht deren Fragecharakter aus, was zeigen und bedeuten sie, wie lassen sie sich für unsere heutige Situation verstehen und wie können sie unser Handeln orientieren? Insofern ist phänomenologische Philosophie auch immer Existenzphilosophie; eine wichtige Frage ist, ob sich nicht auch Existenzphilosophen wie Kierkegaard, Nietzsche und Jaspers, Moralisten wie Pascal und Montaigne, Phänomenologen avant la lettre sind, ob schließlich nicht auch künstlerische Verfahren, die zeigen, wie Welt(en) zum Erscheinen kommen und Geltung erhalten, für philosophische Reflexion bedeutsam sind.
In meiner Magisterarbeit habe ich mich mit dem Sprachdenken E. Levinas‘ und seiner These der Ethik als erster Philosophie‘ beschäftigt. In meiner Dissertation mit Aristoteles‘ Philosophie des Lebendigen und der These, dass seine Metaphysik und Ordnung der Philosophie sich insbesondere über die Lehre von der Seele (psyché) erschließen lässt – bis hin zu den epistemologischen und ethischen Implikationen, die daraus für den Menschen und seinen Umgang mit der Welt erwachsen. Auch hier habe ich die Perspektive der Phänomenologie (Heidegger, Merleau-Ponty und Michel Henry) an den antiken Texten erprobt und zu zeigen versucht, dass sich mit Aristoteles ein interessantes Angebot, den Cartesischen Leib-Seele- bzw. Körper-Geist-Dualismus zu vermitteln, gewinnen lässt – er vieles von der Philosophischen Anthropologie, wie sie dann Scheler und Plessner im 20. Jahrhundert entwickelt haben, kategorial vorgeprägt hat (z.B. mit seinem Begriff des Geistes).
Meine derzeitigen Forschungen setzen sich mit dem Phänomen der Erfahrung auseinander: in der Philosophie und den Sozialwissenschaften. Hintergrund dafür ist die Frage nach Strukturen der Intersubjektivität und der Lebenswelt. Zentral sind hier für mich Themenfelder der alltäglichen Bedeutung dieser Strukturen für die Reflexion bildungsphilosophischer und didaktischer Kontexte im Lehramtsstudium Philosophie und Ethik. Vor meiner jetzigen Stelle habe ich an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz die philosophischen Anteile in den wirtschafts- und transformationswissenschaftlichen Studiengängen verantwortet, davor an der Universität Mainz am Philosophischen Institut gelehrt und geforscht, dort die Eugen Fink-Forschungsstelle für phänomenologische Anthropologie und Sozialphilosophie aufgebaut; Stationen davor waren Freiburg und Heidelberg.